Wenn man an einem coronagewöhnlichen Donnerstag mitten im Januar mit dicken Wanderschuhen und einem sehr großen Wanderrucksack auf dem Rücken in der norddeutschen Tiefebene gesehen wird, bekommt man Blicke. Blicke, die einen Tick länger dauern als die normalen Gehst-du-links-oder-rechts-an-mir-vorbei-Blicke. Oder auch die etwas forscheren Ich-ruf-meinen-Hund-nicht-zurück-Der-tut-nichts-Blicke. Es sind viele überraschte Blicke. Auch manche misstrauische Blicke. Aber die meisten Blicke sind freundlich-erstaunt. Oft folgt ein Lächeln.
Die ganz Mutigen sprechen eine auch an: „Auf großer Tour?“ heißt es dann. Oder „Wo geht’s hin?“ oder „Wie weit noch?“ oder „Schon lange unterwegs?“
Ältere Männer fragen auch gern: „Ganz allein unterwegs?“ Das fragen sie allerdings auch, wenn ich mit Freundinnen zu zweit, zu dritt oder sogar zu viert unterwegs bin. „Ganz allein?“ Als würden wir vier Freundinnen nur deshalb, weil uns zufällig dieselbe Geschlechtlichkeit zugeordnet wurde, zu einer einzigen Person verschmelzen, die mutterseelenallein auf weiter Flur durch die Landschaft stapfen muss, die Arme. Ihre vier Münder quatschen zwar die ganze Zeit, ihre vier Rucksäcke wiegen zusammen knapp 80 Kilo, sie könnten also den Mann locker tragen oder umhauen, sind aber trotzdem zu viert ganz allein, findet der ältere Mann.

Darauf muss man nichts antworten. Dazu müsste man nämlich sehr weit ausholen und den Zusammenhang von Patriarchat, Kapitalismus und Freizeitwandern erklären, wozu man aber weder Zeit noch Lust hat. Man lächelt einfach müde und geht vorbei.
Aber auf die anderen Fragen, auf die möchte man vorbereitet sein. Sonst steht man am Ende da, grinst verlegen und weiß nicht, was man antworten soll. Denn man ist ja gar nicht „auf großer Tour“, sondern will nur mal eine Nacht draußen schlafen, um dem Coronakoller ein Schnippchen zu schlagen. Man weiß auch nicht, wie weit es noch ist, weil man noch nach einem geeigneten Platz zum Übernachten sucht – nicht zu nah am Weg, nicht in Sichtweite von Häusern, aber das Schwierigste ist: Man möchte am liebsten keine Autobahn hören. Das ist das Schwierigste in Deutschland, zumindest für Norddeutschland kann ich das sicher behaupten. Denn Norddeutschland besteht eigentlich ausschließlich aus Autobahnen.
Zwischen die Autobahnen sind Großstädte gequetscht oder Agrarwüsten und zwischen den Großstädten und Agrarwüsten sucht man mit einer Lupe oder Gleitsichtbrille oder sehr guten Augen auf einer Landkarte nach unbebauter und nicht veragrarter Fläche und findet: Ein kleines Naturschutzgebiet! Aber da darf man wiederum nicht übernachten und möchte es auch nicht, denn man wähnt dort möglicherweise eine rastende Gans, die ganz gern ihre Ruhe hätte oder einen Specht, der einem mit hämmernden Morsezeichen zu verstehen gibt, DAS – MAN – HIER – NICHT – ER – WÜNSCHT – IST und doch bitte auf eine der zahlreichen Autobahnen ausweichen möge, mit denen die eigenen Artgenossen – also meine, nicht die des Spechts – Norddeutschland planiert haben. Da hat er Recht, der Specht, denke ich, und fahre weiter mit dem Finger über die Landkarte.



Und weiß immer noch nicht, was ich antworten soll. Denn nach einer solchen neugierig-wohlgesonnen gestellten Frage füllen die Blicke sich auch mit der gespannten Erwartung auf eine Antwort. „Ja, schon seit zwei Monaten bin ich unterwegs. Ich durchwandere Europa!“ möchten sie vielleicht hören oder „Ist nicht mehr weit, nur noch knapp 30 Kilometer.“ Oder „Pscht, da hinten ist ein Reh, dass ich jetzt erschießen muss, damit ich später am Lagerfeuer etwas zu essen habe!“ Oder ähnlich abenteuerliche Geschichten oder geschichtsträchtige Abenteuer. Dabei wollte man eigentlich nur zwei, drei Stunden vom Regionalbahnhof entfernt irgendwo auf einem Feld schlafen, ist vollends damit beschäftigt, keine Angst vor umherstreifenden Wildschweinen und umherschießenden Jägern zu haben und eigentlich sowieso Vegetarierin.

Denn darum geht es doch: Mal ein bisschen Luft an die Nase zu bringen, im Gras zu sitzen und einem Flüsschen beim Plätschern zuzuhören, einem Flüsschen, das noch nicht kanalisiert wurde und deshalb noch Plätschern kann. Begradigte Flüsse plätschern nämlich nicht, sie machen gar kein Geräusch mehr, sind völlig verstummt und müssen immer dringend irgendwohin, was erledigen. Der begradigte Fluss ist ein gewässergewordenes Symbol des Kapitalismus, wenn ihr mich fragt. Und um das Plätschern geht es aber beim Wandern, und nicht um den Kapitalismus.
Dann sich auf dem Kocher irgendwas Schnelles kochen. Das ist wichtig, dass es schnell geht. Kartoffelbrei zum Beispiel geht sehr schnell. Oder Couscous. Couscous geht aber nicht wegen der Glutenintoleranz, die man hat und für die man sich sehr schämt, denn keiner glaubt einem sowas: „Glutenintoleranz! Ha!“ höre ich jetzt alle im Chor rufen. „Ist doch alles eingebildet!“ Trotzdem: Couscous lieber nicht. Also Kartoffelbrei. Der wird nur mit einem Teil des kostbaren Trinkwassers angerührt, das man sehr tapfer mit sich herumschleppt. Vier Liter Trinkwasser für zwei Tage. Das ist ordentlich Schlepperei.
Aber in Norddeutschland gibt es kein öffentlich zugängliches Trinkwasser, von trinkbaren Bächen will ich gar nicht erst anfangen. Und nach Skandinavien darf man nicht wegen Corona. Also Norddeutschland. Nicht mal öffentliche Toiletten gibt es in Norddeutschland, wo man sich vom Wasserhahn etwas abzapfen könnte. Als müsste man in Norddeutschland nur zu Hause aufs Klo. Oder beim Shoppen im Einkaufszentrum. Oder beim Tanken. Aber dann kostet das Aufs-Klo-gehen schon wieder 70 Cent und am Ende hat man einen bekloppten „Sanifair-Bon“ in den Fingern, von dem man sich für 50 Cent an der Tankstelle was kaufen darf.
Man will aber gar nichts kaufen, denn zufällig braucht man gerade keinen eingeschweißten Scheiblettenkäse, auch keinen Scheibenreiniger und kein kleines Teddybärchen mit roter Schleife und überhaupt hat man gar kein Auto, sondern ist nur hier gelandet, weil man mal aufs Klo musste oder etwas Trinkwasser brauchte. Für den Kartoffelbrei.


Wenn der Kartoffelbrei sich gesetzt hat, denn dann muss er: Sich setzen, nachdem ihm beim Umrühren ganz schwindlig geworden ist. Wenn er sich also gesetzt hat, dann haut man noch ein paar getrocknete Kräuter der Provence auf den Kartoffelbrei und freut sich diebisch darüber, dass man an die Kräuter gedacht hat, denn so ein paar Kräuter peppen den Kartoffelbrei mächtig auf, auch optisch, so dass man meint, nie etwas Köstlicheres gegessen zu haben, als mit heißem Wasser aufgegossenes Kartoffelbreipulver.
Und dann hat man das Zelt aufgebaut und schläft ein mit dem Klang tropfenden Regens auf dem Zelt und mit dem Rauschen des Windes in den Bäumen und auch dem Rauschen der A1 in fünf Kilometer Entfernung. Und mit ganz viel Glück ziehen noch 53 Kraniche über einen hinweg. Man hat kurz den Kopf aus dem Zelt gestreckt und sie gezählt, weil man das so gelernt hat als ordentliche Hobby-Ornithologin. Ich kann keine Vogelschwärme mehr anschauen, ohne sie zu zählen, seit ich einmal mit beim Vögel-Zählen war. Sehe ich einen Schwarm Vögel, ist die Reihenfolge so: Ich muss sie erst bestimmen, dann zählen, dann sagen oder denken „Guck mal, 25 Kiebitze!“ Erst dann kann ich mich darüber freuen, denn Kiebitze habe ich lange nicht gesehen, anders als zum Beispiel Kraniche.
Kraniche haben sich unheimlich ausgebreitet. Tausende gibt es jetzt davon, überall lungern sie herum, sogar im Winter hauen sie nicht mehr ab, sondern machen es sich schön gemütlich, am Schaalsee zum Beispiel oder im Wendland. Möchte man in einer flammenden Rede auf das Artensterben aufmerksam machen, sollte man auf keinen Fall mit dem Kranich ankommen. Dann kann man es gleich mit der Straßentaube versuchen. Leider gibt es aber reichlich andere Vögel, mit denen man für mehr Artenschutz werben kann, Kiebitze zum Beispiel. Manche gibt es auch gar nicht mehr, aller Werbung zum Trotz fanden sie wegen Autobahnen und Agrarwüsten keine angemessenen Orte mehr zur Aufzucht ihrer Jungen.
Darum geht es jedenfalls, dass man dann so im Zelt liegt und es gar nichts weiter zu denken und zu tun gibt außer zu lauschen und zu versuchen, keine Angst zu haben vor Jägern oder Wildschweinen. Denn streng genommen darf man hier gar nicht übernachten. Hier in der norddeutschen Tiefebene, eine Niederung ist es sogar, mit einem Flüsschen, das von Ost nach West fließt und viel Weite vor dem Waldrand. Man darf nur die Nacht hier verbringen, wenn man angelt oder jagt, für Vegetarierinnen ist es verboten. Deshalb hat man ein wenig Angst, man könnte entdeckt und verjagt oder geangelt werden.

Doch wenn beides gelingt, das Lauschen und das Keine-Angst-haben, dann schläft man vielleicht sogar kurz richtig ein. Bis man aufs Klo muss. Immer so um zwei Uhr nachts ist das. Egal, wie viel man vorher extra nicht getrunken hat. Man muss immer so gegen zwei Uhr nachts einmal pinkeln. Um zwei Uhr nachts ist allerdings der Schlafsack besonders warm und besonders kuschelig. Er hat sozusagen sein Kuscheligkeits-Tagesmaximum erreicht, was dazu führt, dass man auf gar keinen Fall raus will aus dem Schlafsack. Man muss aber.
Auf Polarexpeditionen haben sie Flaschen dabei mit großen Öffnungen, in die man pinkeln kann, ohne dass man das Zelt verlassen muss. Mit etwas Geschick muss man nicht mal den Schlafsack verlassen, und am Ende schraubt man den Deckel drauf und hat noch eine schöne, 37 Grad warme Wärmflasche im Schlafsack. Aber ich habe mich bisher noch nicht getraut das auszuprobieren, obwohl ich mich schon einiges andere getraut habe: Ich habe schon mit der Urinella Pinkelhilfe im Stehen gepinkelt und sogar ohne eine Urinella im Stehen gepinkelt. Ich habe schon von einem Kajak aus in die Ostsee gepinkelt, ohne dass das Kajak gekentert ist. Und ich habe beim Skifahren schon mit Skiern an den Füßen in den Schnee gepinkelt, denn ohne Skier sinkt man ein, und es pinkelt sich nicht sehr gut so im tiefen Schnee versunken.

Das Allerbeste ist aber das Aufwachen morgens. Falls man geschlafen hat. Ich weiß nichts Besseres als morgens in einem Zelt aufzuwachen. Jedenfalls im Moment nicht, wo ich nicht länger nachdenke, sonst würde mir vielleicht doch noch was Besseres einfallen. Man wacht also auf, der Regen hat aufgehört, man hört wieder die 53 Kraniche, die einen diesmal in kleinen Gruppen mit ihrem Morgenruf begrüßen, zieht allerlei Reißverschlüsse auf und schaut auf das plätschernde Flüsschen, das auch heute nichts weiter erledigen muss als zu plätschern, schaut auf einen wolkenverhangenen Himmel, dessen Grautöne einem vorkommen, wie die schönsten Farben des Regenbogens, schaut auf einen Baum, der noch so dasteht wie gestern, weil er auch nichts Bestimmtes erledigen musste und du denkst: Das ist das Allerschönste, was ich je erleben werde.
Diese Ruhe und dieser Frieden und diese klare Luft an einem Freitagmorgen Mitte Januar bei ungefähr 4 Grad in der norddeutschen Tiefebene zwischen Flüsschen und Wald. Nur das Rauschen der A1 in der Ferne verrät, dass es immer noch Autobahnen gibt und der Kapitalismus über Nacht nicht abgeschafft wurde. Aber dir geht es so gut, dass dir sogar das heute nichts ausmacht.
Und darum gehe ich so gern zelten. Auch im Winter.
Hinweis der Redaktion: Natur- und Umweltschutz sollte auch beim Zelten oberste Priorität haben. Erkundige dich daher vor deiner Reise, wo du am besten dein Zelt aufschlagen kannst. Tipps gibt es zum Beispiel in diesem Artikel von Bergfreunde.
Text und Fotos: Andrea Sievers
PS. Weitere Abenteuer von Andrea findest du auf ihrem Blog, schau‘ dort auch einmal rein!
Skandinavienverliebt, outdoorbegeistert, vogelverrückt - so würden mich wohl meine Freundinnen beschreiben. So oft wie möglich will ich raus, am liebsten irgendwo wild zelten. Will niemand mit, zieh ich alleine los. Dann sind die Sinne noch offener und der Kopf ganz frei. Am liebsten bin ich im Norden unterwegs: Zu Fuß, mit dem Rad, auf Schlittschuhen, Ski oder im Seekajak. So klimafreundlich wie möglich zu reisen und in der Natur möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, ist für mich kein Verzicht, sondern Ansporn und Entschleunigung. Fliegen möchte ich nicht mehr und ein Auto besitze ich nicht, aber ein tolles Fahrrad, gute Wanderschuhe und reichlich Enthusiasmus!
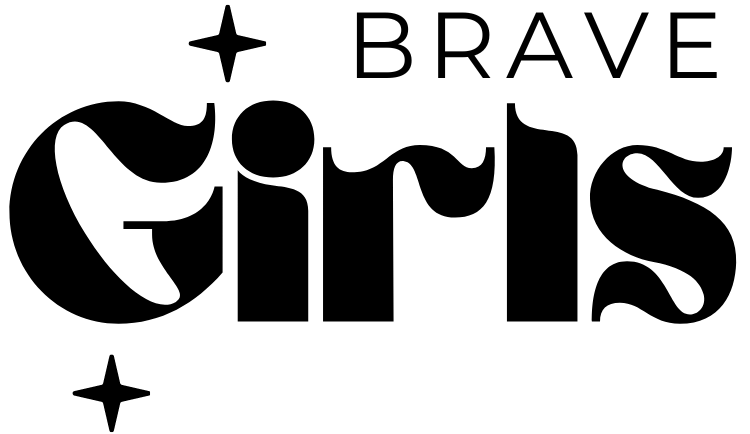





Ein Kommentar
Tolle Bilder, netter Text, vielleicht ein wenig zu oft Kapitalismus, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und wenn jetzt noch Toilette statt diesem Unwort verwendet würde, wäre das ganz klasse 😉
P.S. Mein privater Specht interessiert sich übrigens nicht für mich, der durchlöchert meinen Baum, während ich beinahe daneben stehe.
P.P.S. Falls Ostfriesland dazugehört, zu dem Norden, da gibt es überhaupt gar nicht keine Autobahnen. Wenn mich nicht alles täuscht.